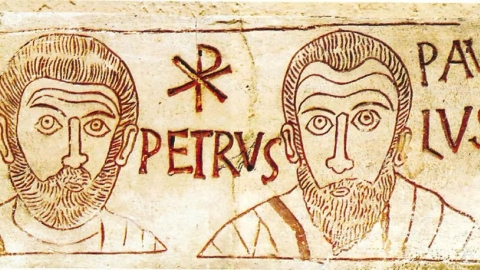Fronleichnam: Das immerwährende Wunder

Leo XIII. und die eucharistische Frömmigkeit
Vor 110 Jahren, am 28. Mai 1902, veröffentlichte Papst Leo XIII. seine Enzyklika Mirae caritatis, die Magna carta der Eucharistie-Verehrung in der Römischen Kirche.
Der Papst beschreibt das Sakrament der Liebe als Keimkraft der drei göttlichen Tugenden: Es vermehrt den Glauben, es stärkt die Hoffnung und entzündet die Liebe.
Würden doch die Christen dieses immerwährende Wunder recht schätzen:
„Als Wunder ist es das größte in seiner Art, und zahllose Wunder begleiten es. Alle Gesetze der Natur sind in ihm aufgehoben. Die ganze Substanz des Brotes und des Weines wird in den Leib und das Blut Christi verwandelt, die sinnenfälligen Gestalten von Brot und Wein bleiben durch Gottes Kraft ohne substanzielle Träger erhalten, der Leib Christi ist zugleich an all den vielen Orten gegenwärtig, an welchen das Sakrament gewirkt wird. Der menschlichen Vernunft aber kommen die Wunder, welche in alter und neuer Zeit geschehen sind und das allerheiligste Sakrament verherrlichen, zu Hilfe, damit sie gegen das hehre Geheimnis ihre tiefste und gehorsamste Ergebenheit betätige. Öffentliche und ausgezeichnete Denkmäler an vielen Orten bezeugen diese Wunder. So nährt also dieses Sakrament vor unsern Augen den Glauben, bestärkt die Vernunft, entkräftet die Entstellung der Gegner und beleuchtet mit hellstem Licht die Ordnung der übernatürlichen Dinge.“
Der Papst erinnerte daran, dass die hl. Messe die Brücke ist zwischen Erde, Himmel und Fegefeuer:
„Die Gemeinschaft der Heiligen ist ja bekanntlich nichts anderes als die gegenseitige Mitteilung der Gnadengaben, Sühnungen, Gebete, guten Werke, durch welche die im Glauben zum himmlischen Vaterlande schon erhobenen, die im Reinigungsfeuer zurückgehaltenen und die noch auf Erden pilgernden Gläubigen zu einem großen Reiche zusammengeschlossen sind, dessen Haupt Christus, dessen Bindungskraft die Liebe ist. In diesem Glauben ist es begründet, dass wenngleich nur Gott allein das hehre Opfer dargebracht werden soll, es doch auch zur Ehre der Heiligen gefeiert werden darf, welche mit Gott herrschen, der sie gekrönt hat. Denn wir sollen auf diese Weise ihren Schutz erlangen und auch, wie es die apostolische Überlieferung lehrt, die Makeln der Brüder tilgen, die im Herrn verstorben sind, ehe sie volle Sühne geleistet hatten.“
Am Ende thematisierte der im Jahr 1903 gestorbene Pontifex mit großer Trauer den Abfall der Völker von Glauben und Sittlichkeit:
„Wenn je ein Zeitalter, so hat das unsere die Geister mit Trotz gegen Gott erfüllt. Wieder ist das frevelhafte Wort gegen Christus laut geworden: ‚Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche‘ [Lk 18,14]. Wieder der frevelhafte Vorschlag: ‚Lasst uns ihn ausrotten‘ [Jer 11,19]. Ja, viele arbeiten mit dem heftigsten Ungestüm und Nachdruck auf die völlige Lostrennung der bürgerlichen und damit der ganzen menschlichen Gesellschaft von Gott hin, dessen Gedanken sie von ihr gänzlich fernzuhalten suchen. Noch ist man allerdings nicht zur Verwirklichung dieses verbrecherischen Wahnes gelangt, aber dennoch [ist] es zu bejammern, dass so viele die Majestät Gottes, seine Wohltaten und das von Christus erworbene Heil vergessen. Die Aufgabe, die Schädigungen dieser Nichtswürdigkeit und Saumseligkeit nun auszugleichen, muss fürderhin durch Vermehrung des frommen Eifers zur gemeinsamen Verehrung des eucharistischen Opfers erfüllt werden. Mit nichts vermöchten wir, Gott mehr zu ehren und mit nichts mehr zu erfreuen. Denn göttlich ist das hier dargebrachte Opferlamm. Mit ihm erweisen wir der erhabenen Dreifaltigkeit jene Verehrung, welche ihre unendliche Heiligkeit erheischt. Eine Gabe von unendlichem Werte und Lieblichkeit bringen wir in ihm dem Vater dar, seinen Eingeborenen. So sagen wir in diesem Opfer Gott nicht nur Dank, sondern wir betätigen ihn wirklich. (…) Wenn die Seele die Flut der Laster bedenkt, welche überall hindringt, seit, wie gesagt, die Hoheit Gottes nicht mehr bedacht, ja verachtet wird, muss sie Betrübnis erfüllen. Es ist, als wollte vielfach das menschliche Geschlecht den göttlichen Zorn um jeden Preis über sich herabrufen, als ob nicht schon in der Saat der Übel, die auf ihm lasten, die gerechte Ahndung bereits reif geworden wäre. Zu regem frommem Wetteifer müssen deshalb die Gläubigen entbrennen, um die Rache Gottes gegen diese Untaten zu versöhnen und der unheilschwangeren Zeit zur rechten Stunde von der göttlichen Erbarmung Hilfe zu bringen. Mögen sie erkennen, dass dies hauptsächlich mit Hilfe dieses Opfers zu erstreben ist. Denn der göttlichen Gerechtigkeit kann der Mensch nur ganz und völlig genugtun, er kann ihrer Milde reiche Gaben nur erlangen – in Kraft des Todes Christi. Diese Kraft der Sühne und Fürbitte wollte Christus aber in der Eucharistie stets unvermindert erhalten, die nicht nur eine leere Gedächtnisfeier seines Todesopfers, sondern dessen wahre und wunderbare, wenngleich unblutige und geheimnisvolle Erneuerung ist.“
Leo XIII. rief dann die Gläubigen auf, „ihre Liebe und Ergebenheit gegen das allerheiligste Sakrament“ neu zu beleben. Er dachte vor allem an „die Bruderschaften zur Erhöhung des Glanzes der eucharistischen Feierlichkeiten und zur immerwährenden, Tag und Nacht fortgesetzten Anbetung des erhabenen Sakramentes oder auch zur Sühnung der Unbildungen und Beleidigungen, welche ihm angetan werden.“ Außer Übung gekommene Frömmigkeitsformen seien wieder aufzunehmen, „so die eucharistischen Bruderschaften, die Betstunden vor dem ausgesetzten Allerheiligsten, die feierlichen, ihm geweihten Prozessionen, die Begrüßungen vor dem göttlichen Heiligtume des Tabernakels und andere heilige und heilsame Übungen dieser Art“.
Möge das kommende Fronleichnamsfest ein Barometer für den Eifer jedes einzelnen Katholiken sein. Kommen Sie zahlreich zu den Prozessionen, bringen Sie Katholiken aus ihrer Umgebung mit. Helfen Sie mit Eifer bei den Vorbereitungen in den Kirchen und Kapellen.